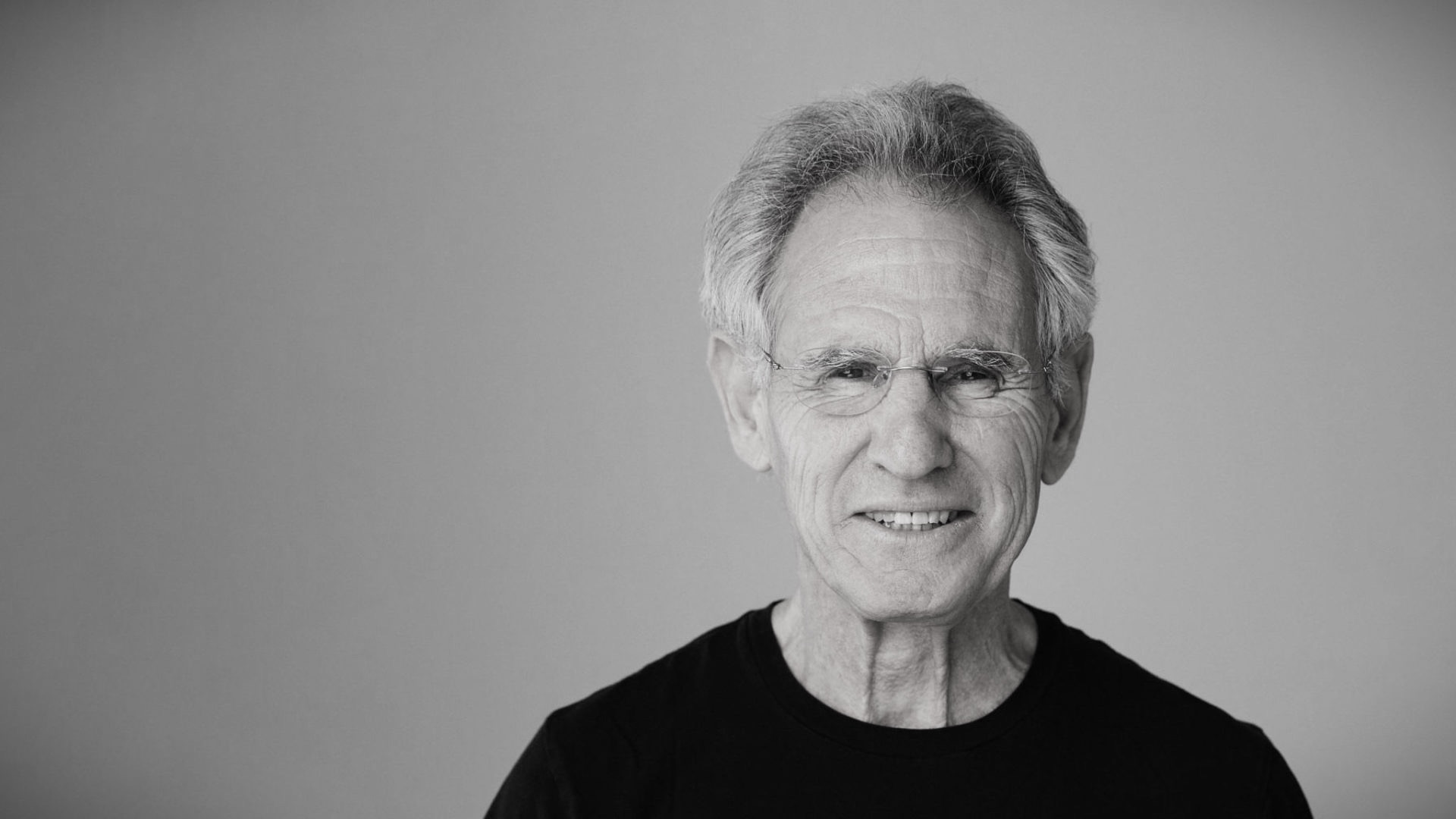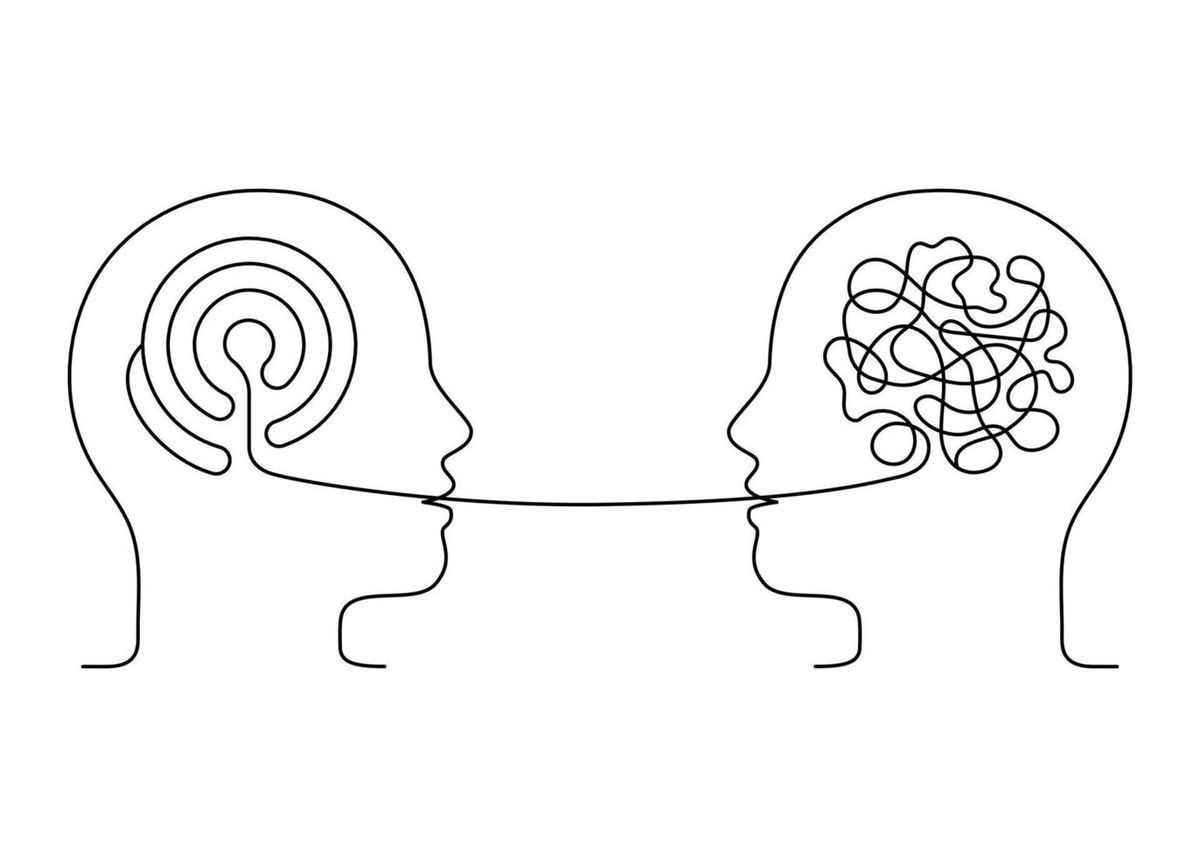Klaus Ottomeyer, Psychotherapeut und Soziologe
20. Mai 2025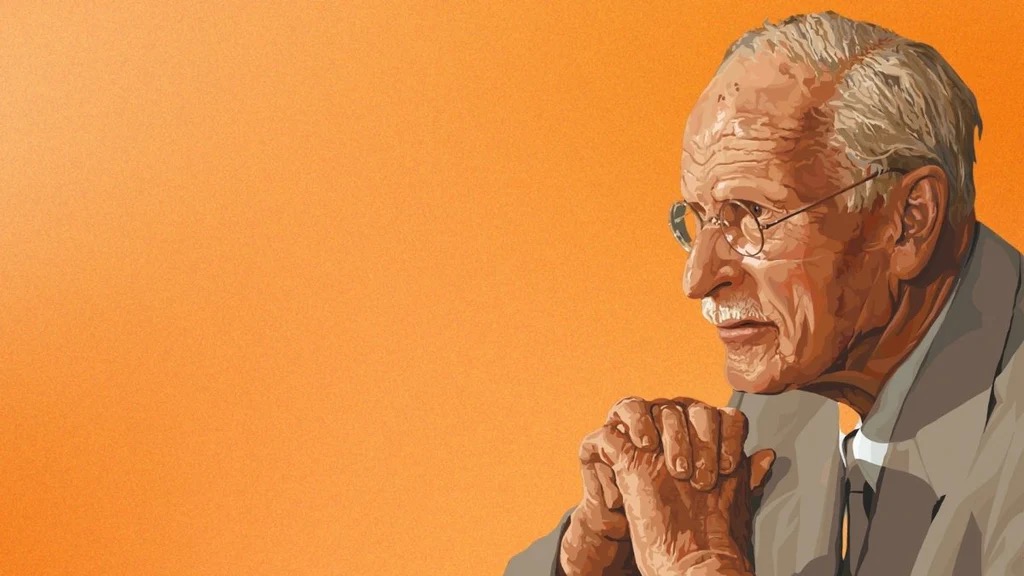
Wie man mit emotional unreifen Menschen und Verwandten umgeht – Carl Jung
12. September 2025Zentrale Thesen
1. Keine Erbschuld durch Geburt
Bleisch argumentiert, Kinder hätten nicht automatisch eine Schuld gegenüber ihren Eltern allein dadurch, dass sie geboren wurden und aufgezogen wurden. Geburt und Fürsorge sind keine Leistungen, mit denen ein Kind sich bewusst einverstanden erklärt oder deren Gegenleistung vertraglich festgelegt wurde.
2. Pflichten entstehen aus Beziehung, nicht automatisch
Statt einem generellen Schuldverhältnis sieht Bleisch Pflichten als etwas, das aus der Qualität der Beziehung entsteht: aus gegenseitiger Liebe, Aufmerksamkeit, Respekt und dem gelebten Interesse. Wer in einer liebevollen Beziehung aufgewachsen ist, fühlt oft Dankbarkeit – aber das ist nicht gleichbedeutend mit einer moralischen Pflicht.
3. Besondere Verletzlichkeit in der Eltern-Kind Beziehung
Diese Beziehung ist einzigartig: man kann sie nicht kündigen, man kann Eltern und Kinder nicht wählen. Das erzeugt eine bestimmte Form von Verletzlichkeit – Erwartungen, Machtverhältnisse, emotionale Verflechtungen. Diese besonderen Gegebenheiten bergen Chancen (Nähe, Identität, Zugehörigkeit), aber auch Risiken (Enttäuschung, Überforderung) in sich.
4. Grenzen von Pflichtgefühl und Schuld
Bleisch kritisiert, dass viele Menschen sich aus gesellschaftlichem Druck, Tradition oder impliziten Erwartungen (z. B. „gute Kinder“, Pflichtgefühl) schuldig fühlen, obwohl sie vielleicht selbst Grenzen haben oder die Beziehung schwierig ist. Sie sagt, Schuldgefühle allein sind kein guter Maßstab dafür, was man tun sollte.
5. Wechselseitige Verantwortung
Eltern haben nicht nur in der Kindheit Pflichten und Aufgaben; auch in der Beziehung zu erwachsenen Kindern bleibt Verantwortung bestehen – für das Kind als Person, in Bezug auf Fürsorge, Respekt, die Art wie Eltern über das Kind denken und wie sie zu ihm stehen. Gleichzeitig hat das Kind Rechte, eigene Freiheiten, eigene Grenzen.
⸻
Beispiele und Illustrationen
• Bleisch nennt das Beispiel: Muss ein Kind seine Pflege übernehmen, wenn die Eltern im Alter pflegebedürftig sind, allein weil sie in der Kindheit viel gegeben haben? Sie sagt: Nicht automatisch. Es hängt davon ab, wie die Beziehung ist. Wenn die Fürsorge einseitig war oder Verletzungen stattfanden, dann ist die Pflicht, sich zu kümmern, nicht zwingend moralisch zwingend.
• Auch das Beispiel von Geburtstagen, Kontakt trotz eigener Belastungen: Viele erleben innerlich den Gesellschafts- oder Familiendruck, „man müsse da sein“, obwohl es emotional schwierig ist. Bleisch regt an, sich bewusst zu machen, welche Erwartungen echt sind, und wo man vielleicht Grenzen setzen muss.
• Sie vergleicht Freundschaft: Man fühlt sich Freunden verbunden, hilft ihnen – nicht weil man „Schuld“ hat, sondern weil Beziehung bedeutet, dass man sich interessiert, eingesetzt hat, etwas füreinander war. Ähnlich könnte man zu Eltern stehen – aber eben nicht aus der Logik einer Schuld, die man abarbeiten müsste.
⸻
Reflexion / Grenzen
• Wo zieht man die Grenze?
Wenn Beziehung sehr belastet war (Missbrauch, Vernachlässigung), darf ein Kind durchaus klar sagen, dass es nicht in Nähe sein will oder nicht zu leisten imstande ist, was andere erwarten. Bleisch sieht in solchen Fällen auch das Recht auf Distanz.
• Gesellschaftlicher Rahmen
Auch wenn moralisch nicht jede Pflicht gerechtfertigt ist, leben wir in Gesellschaften mit Normen, Gesetzen und kulturellen Erwartungen (z. B. Unterhaltspflichten, Pflege in Seniorenheimen etc.). Diese Rahmenbedingungen beeinflussen, was Menschen tun oder zu tun meinen. Bleisch macht klar, dass diese Normen kritisch hinterfragt werden sollten.
• Emotionale Komplexität
Gefühle wie Dankbarkeit, Schuldgefühle, Loyalität sind stark, und sie lassen sich nicht einfach „abschalten“. Bleisch schlägt nicht vor, sie zu verdrängen, sondern sie zu reflektieren: Woher kommen sie? Helfen sie der Beziehung, oder belasten sie ungerecht? Manchmal ist es nötig, mit Eltern über Erwartungen zu sprechen, Kompromisse zu finden.
Transkribiert von Robert Zeugswetter